Olympischer Realismus - ernüchternd und hoffnungsvoll zugleich
Gerade die älteren Zeitgenossen stellen sich immer wieder die Frage nach der Akzeptanz von Entwicklungen, die aus dem Ruder zu laufen scheinen. Die nachgesagte Weisheit des Alters sollte sich aber nicht auf das Urteil beschränken, sondern auch das Nach- und Vorausdenken einschließen. Schnell ist man sonst bei Einschätzungen angelangt, die nicht mehr in die aktuellen Rahmenbedingungen und damit nicht mehr in die Zeit passen.

Das gilt auch für Olympia und den Fortbestand der Spiele. Selbst ich als schon etwas lahmender Oldtimer der olympischen Szene stelle mir oft genug die Frage: „Sind das noch deine Spiele?” Zum Glück und Segen Olympias sind es meine Spiele nicht mehr, denn die Zeit ist fortgeschritten und ein Verbleiben auf Althergebrachtem kaum noch zeitgemäß.
So hat auch Olympia sich gewandelt, wenn auch auf höchst eigenständige Art. Vom uralten Grundgedanken ausgehend, hat das beginnende technische Zeitalter neue Vorstellungen hinzugefügt, die schließlich so interessant gewesen sein müssen, dass sich heute ein ganzer Globus (zumindest auf sportlichmenschlicher Ebene) mit dieser Idee identifiziert. Vielleicht steckt auch hier ein gehöriges Maß an materiellem Profitstreben dahinter, aber eben das ist nun mal ein Zeichen der Zeit. Auch Olympia wird seine Wechsler nicht mehr aus dem Tempel treiben können.
Man mag diese Entwicklung der Spiele begrüßen oder bedauern, ihr Fortgang scheint – zumindest aus heutiger Sicht – gesichert. Großflächige Korrekturen dürften ebenso ausgeschlossen sein wie ein Zurückdrehen auf früher gültige Strukturen. Olympia hat ohnehin schon überraschend viel Altgültiges bewahrt, denken wir nur an Zeremoniell und Management. Die Spiele selbst werden eingebettet bleiben in die Entwicklung der Technik und die Ansprüche der elektronischen Medien.
Das braucht keine schreckliche Vorstellung zu sein, wenn auch der künftige Gang der Dinge kaum vorausschaubar bleibt. Glaubten vor einhundert Jahren noch viele an eine vollmechanisierte, zubetonierte Landschaft und die vom Big Brother reglementierte Gesellschaft, so verlief doch die Entwicklung in eine ganz andere Richtung. Die Technik wurde nicht monströser, sondern diffiziler, während die zwischenmenschliche Kommunikation durch die Erreichbarkeit per Handy und Internet alle vorstellbaren Grenzen in atemberaubendem Tempo überwand.
Olympia war in der Vergangenheit das Synonym für das Zusammengehen von sportlicher Höchstleistung und fairem Miteinander im Rahmen eines allseitig anerkannten Reglements. Die Spiele selbst sollten offen sein für alle, die dem sportlichen, nicht jedoch dem materiellen Gewinnstreben nachgingen. Insoweit waren die Athleten mit ihren Leistungen bewunderte und vielfach auch vorbildhafte Zentralfiguren des olympischen Geschehens. Bei allem Können jedoch blieben sie in Erscheinung und Streben Menschen wie wir anderen auch. Die Anzahl der beteiligten Nationen war wohl zunächst nur für die Statistik von Bedeutung. Trotz dieser noch überschaubaren, von Abwegigkeiten kaum gestörten Szenerie blieb der so genannte olympische Gedanke Undefiniert, obwohl fast alle von dieser Idee schwärmten. Noch hatte das elektronische Zeitalter keinen Besitz von Olympia ergriffen.
Ganz anders heute. Das Wort vom gezüchteten Athleten sollte man zwar sparsam gebrauchen, aber nicht aus dem Sprachschatz streichen. Schon im Erscheinungsbild sind viele Athleten eben nicht mehr Menschen wie du und ich, sondern gezielte Resultate von ursprünglichem Talent, lebensfremder Ausbildung und chemotechnischen Attributiv (was in der guten Regel kein Doping zu sein braucht).
Nicht mehr in allen Fällen beurteilen wir deshalb die zur olympischen Schau angetretenen Athleten als unseresgleichen. Sie sind in unseren Augen und Empfindungen eher Schauspieler und Bühnendarsteller wie die Primadonnen und Heldentenöre der Theaterwelt. Auch die haben harte Lehrzeiten, schwierige Laufbahnhürden und harten Wettbewerb meistern müssen, bis sie im strahlenden Rampenlicht standen. Erst dann werden sie bewundert und hofiert wie die Olympiasieger.
Was für die Stars der Bühne ein Auftritt in Bayreuth, in der Metro oder in der Scala bedeutet, ist für die Stars des Sports ein Auftritt bei Olympia. Auch die sportlichen Spitzenkönner und selbst die bestbezahlten Professionals pfeifen (vorübergehend) auf das Erfolgs-Salär, wenn es um olympisches Gold geht. Und für die nicht mit Edelmetall geschmückten Athleten bleibt dennoch die Teilnahme an den Spielen ein unauslöschbarer Gewinn, der auch persönliche Enttäuschungen vergessen lässt. Olympia fasziniert alle – da geht kein Weg dran vorbei!
Faszinierend auch, wie sich das olympische Geschehen inzwischen zu einem großen Spektakel, zur Entertainment-Show entwickelt hat. Das braucht beileibe kein Tadel zu sein. Die Perfektion der olympischen Regie lässt die sportliche Selbstdarstellung der bunten Athleten-Schar oft genug zu einem Augenschmaus, aber auch zu einem spannenden Erlebnis werden, das allen großen „Events” unserer Zeit durchaus den Rang abläuft.
Auch hier gibt es kaum etwas zu kritisieren, erst recht, wenn man an die glanzvollen Tage von Sydney zurückdenkt. Diese Spiele waren ein wundervolles Erlebnis-Programm – nicht nur für die unmittelbar teilnehmenden Besucher, sondern auch für die Abermillionen Fernsehzuschauer in aller Welt.
Es mag zwar hart klingen, dürfte aber durchaus realistisch sein: Nicht die athletischen Protagonisten bestimmen den Fortbestand der Spiele, sondern die Vielzahl der teilnehmenden und auch erfolgreichen Nationen, vor allem aber die für gut zwei Wochen am Bildschirm vereinte ganze Welt.
Das hätte wohl auch ein Coubertin sich nicht träumen lassen. Zwar wollte auch er „all sports and all nations“, aber natürlich ohne Professionals und sogar zunächst einmal ohne Athletinnen. Und gerade diese beiden Gruppen bestimmen heute viele olympische Sportarten. Selbstverständlich wollte der Vater unserer modernen Spiele alle Kontinente einbeziehen, aber er konnte sich noch kein Bild von der Assistenz und beiderseitigen Nutznießung des Fernsehens machen, ohne das heute nichts mehr läuft. Weder beim Ausrichter noch bei den Olympiern von Lausanne.
Diese weltweite visuelle olympische Präsenz könnte man notfalls noch dem gestiegenen Unterhaltungsbedürfnis und der Schausucht der modernen Menschheit zuordnen. Doch auch der unbedarfte Teil dieser TV-Konsumenten wird (hoffentlich) nicht übersehen haben, dass Olympia in Sydney nicht nur fast 200 große und kleine Völker vereinte, sondern auch politische und ethnische Gruppierungen, die draußen außerhalb des olympischen Geschehens nichts voneinander wissen wollen, Händel austragen oder aufeinander losschlagen. Dort auf der olympischen Insel Australien respektierten sie einander, ordneten sich den sportlichen Regeln unter und lagen sich nach dem Wettkampf vielleicht sogar noch freundschaftlich in den Armen. So ist und wurde Olympia nach den Irrungen und Wirrungen in den siebziger und achtziger Jahren wieder ein einigendes Fest, das seinesgleichen in dieser unruhigen Welt vergeblich sucht. Genau das aber verkörpert heute den bislang so unzureichend oder falsch interpretierten olympischen Gedanken.

Vieles hat sich in den vergangenen einhundert Jahren gewandelt, in olympischen Dingen ebenso wie in allen anderen Lebensbereichen. Die Olympischen Spiele sind längst keine herkömmlichen Sportfeste mehr, sondern mehr schon eine politische Demonstration dahingehend, dass bei allen sachlichen und geistigen Gegensätzen ein friedliches Wetteifern möglich ist. So entspricht die olympische
Idee auch weiterhin einer Wunschvorstellung aller Menschen und bleibt ein unüberhörbarer Appell an alle, die in dieser Welt das Sagen haben.

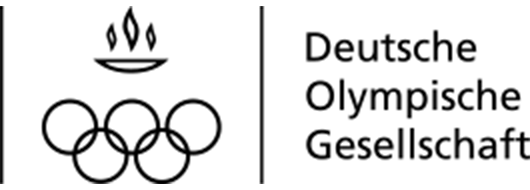
(Hilmar Dressler | Olympisches Feuer, 6/2000, S. 14-16)