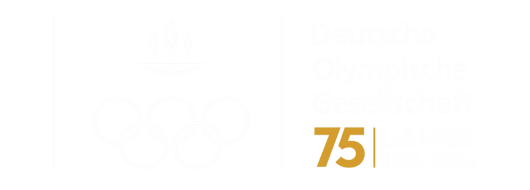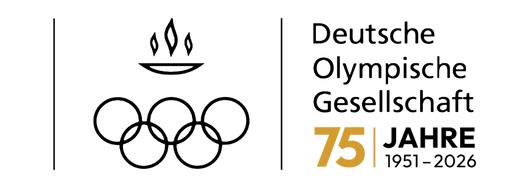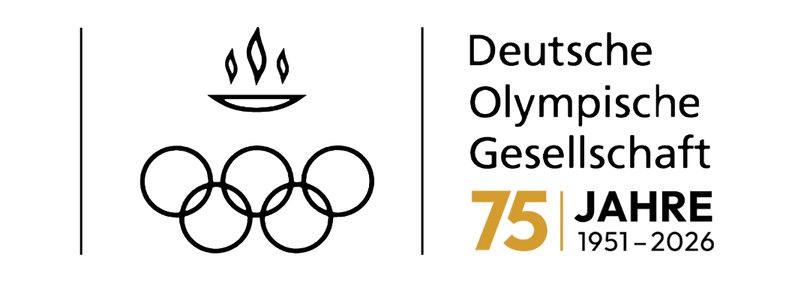Meinung: Warum eine erneute Olympia-Bewerbung Berlins so wichtig und richtig ist – ein Plädoyer von Gerd Graus, Pressesprecher und Leiter Öffentlichkeitsarbeit des Landessportbunds Berlin.
„Wir … für die Spiele“ Diesen Slogan hat die DOG Berlin der von ihr ins Leben gerufenen Bewegung zur Unterstützung der Berliner Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele gegeben. Die drei Punkte lassen Raum für Träume, Fantasie und Tatkraft. Wir brennen für die Spiele, wenn Metaphern bemüht werden sollen; wir kämpfen für die Spiele, wenn es um Engagement geht; wir malen für die Spiele, wir singen für die Spiele, wir laufen für die Spiele, wir diskutieren für die Spiele, wenn es darum geht, Aktionen zu starten. An Schulen, in Vereinen, auf der Straße – dann, um mit Menschen zu diskutieren und ihnen zu erläutern, warum es – trotz verständlicher Vorbehalte – viele gute Gründe gibt, sich für eine Berliner Bewerbung einzusetzen.
„Berlin+“ heißt das Konzept, das Berlin Ende Mai dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vorgelegt hat. Es ist noch ein Grobkonzept, was gar nicht anders sein kann. Der DOSB hatte die interessierten Kommunen aufgefordert, in aller Kürze unter klaren Längenvorgaben ihre Ideen zum Sportstättenkonzept und zur Vision vorzulegen. Innerhalb von knapp drei Monaten. In dieser kurzen Zeit können weder verwaltungstechnisch mit allen beteiligten Verwaltungsstellen die Einzelheiten komplett durchgesprochen noch alle Ideen bis in letzte Details diskutiert werden. Deshalb ist „Berlin+“ tatsächlich noch ein Grobkonzept, welches in den Monaten bis zur Entscheidung des DOSB, mit wem Deutschland ins internationale Rennen gehen soll – diese wird erst Mitte 2026 fallen –, diskutiert, angereichert und verfeinert werden muss. Mit der Berliner Bevölkerung und natürlich auch mit der dem Berliner Sport, der Kulturszene der Stadt und vielen weiteren gesellschaftlichen Teammitgliedern.

Messe Berlin zentraler Ort des Berliner Konzepts
„Wir … für die Spiele“ ist ein wichtiger Bestandteil in diesem Prozess. Schon bei der Auftaktveranstaltung im Marshall-Haus auf dem Gelände der Messe Berlin, die im „Berlin+“- Konzept eine zentrale Rolle als Standort für das Internationale Medienzentrum spielt – als Spielstätte für mehrere Sportarten und Trainingsstätte der Olympioniken, die direkt neben der Messe in ihrem Olympischen Dorf ihre temporäre Heimat finden werden. Das Gelände gehört bereits heute zur städtebaulichen Planung Berlins. Ein neuer Stadtteil wird entstehen, in dem Bewegung und Sport Grundlage der städtebaulichen Planung sein werden.
„Berlin+“ ist aber auch das, was der DOSB zu Anfang seiner Überlegungen, sich wieder für Olympische und Paralympische Spiele zu bewerben, im Sinn hatte. Mit den Partnern Brandenburg mit Potsdam (Triathlon), Frankfurt/Oder (Schießen), Bad Saarow (Golf) und Brandenburg/Stadt (Kanu und Rudern), Sachsen mit Leipzig (mehrere Sportarten) und Markkleeberg (Kanu), Segeln und Mecklenburg-Vorpommern (Warnemünde/Rostock) oder Schleswig/Holstein (Kiel) sowie Nordrhein-Westfalen mit Aachen (Reiten) und einigen Städten als Bestandteil der Fußball-Turniere, ist es eine Bewerbung, die viele Teile Deutschlands einbezieht. Und das alles unter dem Gesichtspunkt, Bestehendes zu nutzen und damit kostenbewusst zu denken – statt nur neu zu bauen und immense Kosten zu verursachen.
Natürlich wird allein die Bewerbungsphase, mehr noch eine Ausrichtung der Spiele, Prozesse zur Förderung des Sports in Gang setzen. In Berlin sind das Velodrom (Bahnradsport) und die Schwimmhalle an der Landsberger Allee (SSE) mit Wettbewerben für Wasserball und Synchronschwimmen Bestandteil des Konzepts. Beide sind als Folge der Olympiabewerbung Berlins für die Spiele 2000 entstanden.
Was ist der Sport anderes als soziale Infrastruktur?
Der Sanierungsstau Berliner Sportstätten ist enorm. Da hilft auch die Sondermilliarde des Sports wenig. Eine Milliarde pro Legislaturperiode ergibt 250 Millionen Euro pro Jahr. Immer noch viel Geld. Aufgeteilt in 16 Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel bleiben für Berlin von der Sportmilliarde 11.025.000 Euro pro Jahr übrig. Deshalb war es wichtig für den Sport, dass er Bestandteil des 500 Milliarden Infrastruktur-Sondervermögens wird. Und doch benötigt der Sport noch die Förderung darüber hinaus.
Wenn das Sondervermögen auch in soziale Infrastruktur investiert werden soll, stellt sich die Frage: Was ist der Sport anderes als soziale Infrastruktur? Das beinhaltet auch das „Berlin+“- Konzept. Der Landessportbund Berlin bringt dies zum Ausdruck, indem der LSB stets betont: „Gebt die Spiele den Kindern.“ Das bedeutet die lebenslange Sportbiografie der Kinder und Jugendlichen von heute, die 2026, 2040 oder 2044 – diese drei Daten müssen für eine Bewerbung ja in Betracht gezogen werden – dann die Athlet*innen sind, die für Deutschland starten. Funktionär*innen im Sport sind, Trainer*innen. Übungsleitende. Die Grundlagen müssen gelegt werden, die Infrastruktur in Kita und Schule geschaffen, damit die Kinder und Jugendlichen die Werte des Sports in Zukunft weiterleben.
Diesen Geist will „Berlin+“ fördern und leben. „Berlin+“ ist auch ein Konzept, das die Athlet*innen in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Sie gestalten die Spiele, von ihren Leistungen, von ihrem Geist, von ihrer Begeisterung leben die Olympischen und Paralympischen Spiele. Die Sportler*innen, die Besucher*innen und die Bewohner*innen der Ausrichterstätten lassen die Spiele zu dem werden, was Paris und London gezeigt haben: zu einem großen Fest des Sports, der Gemeinschaft, des Miteinanders, der Verständigung. Zu dem, was die Spiele ausmacht: Werte zu vermitteln und zu zeigen. Die Menschlichkeit, so wie sie seit der Aufklärung verstanden wird, offensichtlich werden zu lassen. Zu Wochen voller Freude und Spaß. Ja, sogar: Zu Wochen glückseligen Lächelns.